Ritterin des gefährlichen Platzes
Ich
sehe in Harper's Bazaar eine Frau, 1,80m groß, scheinbar ungeschminkt,
mit entschlossenem Gesicht und deutlichem unteren Vorbiß, der diese
Entschlossenheit noch betont, beinahe nackt unter einem durchsichtigen
eisblauen Minikleid von Versace. Die Beine sind muskulöser als bei
einem Model üblich, die Frau ist ja auch keins, sie ist eine berühmte
Schauspielerin und heißt Sigourney Weaver, und vor einem Jahr hat
sie (es ist die Oktobernummer '96) ihre Haut, die in den "Alien"-Filmen
bereits ziemlich viel aushalten mußte, wieder einmal zum Markt getragen.
Die Haut scheint sich seit dem letzten Mal erholt zu haben. Auf der nächsten
Seite trägt sie ein, ebenfalls durchsichtiges, aber dafür bodenlanges
Kleid von Dolce & Gabbana, mit Tigerstreifen gemustert. In dem Interview,
das dazu abgedruckt ist, spricht die Frau über Sex, anläßlich
eines Theaterstücks, das dieses Thema zu haben scheint, und in dem
sie die Hauptrolle spielt. In den Alien- Filmen spielt Sex keine Rolle.
Stattdessen spielt Sigourney die Hauptrolle.
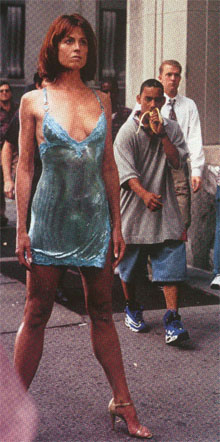
Sigourney
Weaver, Photo: Harper's Bazaar
Es ist erstaunlich, in wie vielen Räumen man Menschen vorfindet, und man erkennt sie dennoch an ihren Gesichtern, die uns manchmal direkt liebgeworden sind, vor allem, wenn sie Filmschauspielern gehören, die man einfach überall wiedererkennen würde, nur vielleicht nicht, wenn sie einem im eigenen Stammlokal entgegenkämen, denn das sind von Natur aus gewiß keine entgegenkommenden Leute. Sie sind uns dauerhaft entzogen und doch, in den Zeitschriften, scheinbar zum Angreifen nahe, wenn sie auch niemals handzahm werden. Das geschieht im allgemeinen dadurch, daß der imaginäre Raum auf der Leinwand immer, selbst wenn er alltägliche Genreszenen zeigt, vom Raum des Alltäglichen getrennt ist. Er fordert die Betrachter auf, danach zu greifen, aber diese ungreifbare, ungerechte Verteilungsgleichung geht nie auf, es ist, als tauchte man seine Hand in Wasser, das ja immer ausweicht. Ist schon der Raum, in dem man lebt, obwohl naturwissenschaftlich recht genau definiert, selbst an der Stelle, an der wir uns aufhalten, deswegen dort noch nicht fester oder dichter, so könnte man dem Geschehen auf einer Filmleinwand, die aber schon das einzige Dichte und Feste am Film ist, an keiner Stelle eine größere Dichte oder Ballung zusprechen, egal, was im Film gerade passiert. Es rauscht vorbei, nicht zu fassen, was da geschieht. Ist der Film ein Krieg der Welten zwischen dem Realen und dem Irrealen, das für uns aber real zu sein hat, je realer desto lieber? Und je unwahrscheinlicher das Irreale des Films ist (am unwahrscheinlichsten naturgemäß in Science-Fiction-Filmen, die ja den gesamten Weltraum mit einbeziehen, also unseren Planeten verlassen), umso mehr bemühen sich die Regisseure, besonders real erscheinen zu lassen, was da gezeigt wird. Möglicherweise damit wir umso leichter Beziehungen zwischen dem Gezeigten und unserer Realität herstellen können.
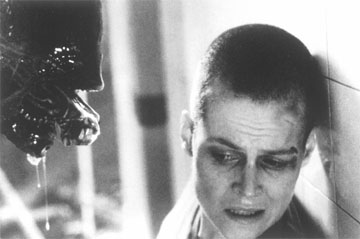
ALIEN3 (David Fincher, 1992, Photo CentFox), aus METEOR, 1997, 11
Vielleicht
rührt die unwillkürliche Scheu, ja Angst, die man normalerweise
bei den Kampfszenen mit diversen Monstern (und die "Alien"-Filme
gehorchen ja dem uralten Schema Mensch gegen Ungeheuer, welches eben nicht-menschlich
ist) empfindet, von der Ahnung her, daß es auch hinter dem Raum,
in dem sich diese Kämpfe abspielen, (so sehr wir auch wissen, daß
es ihn gar nicht gibt), noch einen weiteren geben könnte und dahinter
dann noch einen und so fort, Räume, die einen einzusaugen drohen,
und in denen nichts geschieht, das sich noch auf den Realraum beziehen
würde - es sind ja schon die Welt der Zuschauer und die sich erhellende
Leinwand, auf der einem etwas "erscheint", Räume, welche
in vollkommenster Trennung voneinander existieren - und dann ist da ja
noch das Geschehen auf dieser Leinwand: Das wäre dann ein weiteres
Kontinuum, das sich nicht mehr definieren läßt, weil die Eigenschaften
unseres Lebensraumes darauf nicht zutreffen, auch wenn uns vieles bekannt
vorkommt. Daß uns das, was dort oben alles möglich ist, Angst
macht, wäre die einfachste Erklärung. Aber vielleicht ist ja
alles ganz anders und das, was man als Leere bzw. Räume unterscheidet,
sind Teil von ein- und derselben Mechanik: Die ursprüngliche Naturhaftigkeit
dieser Räume, auch derer, die, im Sci-Film, erst erobert werden müssen,
wäre längst gezähmt durch Fleiß und Industrie, und
die Verursacherin von alldem wäre: Eine Firma, die alles in der Hand
hat und die Räume durch ihre Kolonisten, ihre Fracht- und Handelsschiffe
sowie ihre Abgesandten jeder Ordnung, von der Kommandantin bis zum Androiden,
der natürlich von Den Herren Der Firma hergestellt und programmiert
worden ist, zähmen und beherrschen will, wozu? In erster Linie natürlich
um sie auszubeuten. Der US-amerikanische Romancier Thomas Pynchon (DER
Autor der paranoischen Weltverschwörung, der die "Alien"-Filme
erfunden haben könnte und vielleicht auch erfunden hat) hat, präzise
wie kaum ein andrer vor ihm, von der Naturhaftigkeit (alles an ihnen hängt
zusammen, eins ist mit dem andern verknüpft, und der Zusammenhang
ist die paranoische Verschwörung, und das einzige, das schlimmer
ist als Teil der Verschwörung zu sein wäre: nicht Teil der Verschwörung
zu sein) der großen Konzerne gesprochen. In "Gravity's Rainbow"
ist die Rede vom Schöpfer des kartellisierten Staates, dem später
ermordeten deutschen Außenminister und Sohn des Begründers
des ersten großen Elektrizitätskonzerns AEG, Walther Rathenau,
der, durch die Verknüpfung horizontaler mit vertikalen Strukturen,
dessen Verkünder und Architekt war (allerdings als Sozialutopist,
sozusagen als "guter" Vater seiner Angestellten, während,
ebenfalls in der Weimarer Republik, Alfred Hugenberg, der dazu auch noch
die öffentliche Meinung, die Presse und die Filmstudios, und damit
im wahrsten Sinn des Wortes die Menschen selber besessen hat, vielleicht
als "böser" Herrscher fungieren könnte), gleichzeitig
aber letztlich auch der Auslöser Der Universellen Paranoia. Im modernen
Nachkriegsstaat (gemeint sind nicht nur die beiden Weltkriege, sondern
ALLE Kriege, die anschließend, auch wenn noch partiell gekämpft
werden mag, immer vom Geschäft abgelöst werden, wie nicht zuletzt
die Frachtschiffer in "Alien" uns zeigen) würde keine politische
Gruppierung mehr als Siegerin hervorgehen, sondern eine rationale Struktur,
in der das Geschäft die wahre, die rechtmäßige Autorität
darstellte - eine Struktur, die, wenig überraschend, auf dem basieren
würde, was Rathenau und, mit noch weiter reichenden Konsequenzen,
Hugenberg in Deutschland aufgebaut haben.
Daraus folgt, daß hinter jeder Macht eine weitere stehen muß,
und ihren Eroberungen entsprechen, konkretisiert, alle diese Räume,
hinter denen immer schon die nächsten warten, hüben wie drüben.
Es gibt Die Firma, einen gesichtslosen Kraken, eine Organisation, die
mehr weiß als alle übrigen, weil sie alles steuert, und Die
Firma kennt auch die schreckliche Struktur hinter all den Eroberungen,
hinter all den Fassaden von Vielfältigkeit, Marktwirtschaft, Kolonisierung,
Furcht und Strafe. Und vielleicht hat Die Firma das Alien selbst gebaut
bzw. gentechnisch gezüchtet? Egal wozu. Um Menschen an ihm zu erproben
oder es an Menschen zu erproben. Vielleicht besitzt Die Firma das alles,
was sie zu erobern und auszubeuten vorgibt, bereits und will nur Menschen
und Androiden billig entsorgen, so wie die I.G. Farben, das Kartell, das
sich in Auschwitz, scheinbar widersinnig und gegen die eigenen Produktionsinteressen,
wie z.B. Hannah Arendt nachweist, zur Vernichtung, nicht zu Arbeit und
Produktion niedergelassen hatte. Der Paranoia sind keine Grenzen gesetzt,
sonst wäre sie ja keine. Und immer ähnlicher wird, was Menschen
gemacht haben und machen können, dem was sie nicht machen können,
außer bei Zeugung und Geburt: Natur, zumindest ihre Nachahmung.
Aus Kohlenstoff entstehen organische Verbindungen, entsteht der Benzolring
(ein Gebilde von eigener Schönheit), so hat es angefangen. Inzwischen
wächst Das Kartell selbst organisch, es kann nicht anders, wie die
Natur, und die einzige Konstante in den Alien-Filmen ist die Heldin, Ripley,
Sigourney Weaver, sie ist die einzige, die immer gleich bleibt, nicht
einmal altert, denn sie reist ja so durch die Zeit, daß diese, für
sie, nicht vergeht; alles andre ändert sich, sogar die Tochter altert
und stirbt schließlich als alte Frau (in der Kinofassung geschnitten).
Doch, wie in einem entropischen Vorgang, kann man eine paradoxe gegenläufige
Bewegung wahrnehmen, daß nämlich, je mehr Sigourney rackert
und arbeitet, je mehr sie plant und lenkt (einmal mit Der Firma, einmal
gegen sie. Ist sie die Firma? Ist die Firma sie? Weiß sie überhaupt
von den Machenschaften Des Kartells? Ist sie Teil davon?), nur die Unbelebtheit
wächst, die Beteiligten immer häufiger sterben (die kleine Newt,
die gerade noch, in Teil 2, gelebt hat und liebevoll zur Ruhe gebettet
wurde, ist zu Beginn von Teil 3 durch eine Crashlandung einfach tot und
aus, weg mit ihr!) und alles immer tiefer in einen Todesschlaf zu sinken
scheint, zu allererst Sigourney selbst, die immer resignierter, starrer,
immer steinener zu werden scheint, obwohl sie doch der Angelpunkt von
alldem ist. Und dem Kartell, das alle, auch ihre Fäden zieht, was
sie selbst möglicherweise vergessen hat, vielleicht aber auch nicht,
entspricht eine Film-Firma, die, wie naturhaft, immer neue "Alien"-Filme
produziert, die einfach nicht aufhören kann, warum? Weil es sich
längst verselbständigt hat? Weil sie immer noch Geld damit verdienen
können? Fast scheint letzteres wieder eine zu banale Erklärung
zu sein.
Das alles zu zeigen, ist in letzter Konsequenz nur im Sci-Film möglich,
denn nur in diesen Filmen besitzen die gezeigten Räume (jeder von
ihnen seinerseits auch wieder vieldimensional) gleichzeitig die größte
Realität wie die größte Irrealität, und keine andre
Filmgattung kann die Räume, die Verschwörung Dahinter dermaßen
plastisch bis in allen Einzelheiten evozieren. Dieses Dahinter muß
allerdings dann allein aus sich selbst heraus zeigen, welche Regeln in
ihm gelten: Es sind Regeln, die irgendwelche Leute aufgestellt haben,
die nicht genannt zu werden wünschen, auch wenn sie gezeigt werden.
Sie haben keine Ähnlichkeit mit Spendern, die gerne ungenannt bleiben
möchten. Uns Zuschauern sind die Erfahrungen jedenfalls nicht gegönnt,
die Sigourney Weaver in den Alien-Filmen machen muß, sie erfährt
das alles an unserer Statt, wir würden sowas nicht im Traum erleben
wollen, wie man so sagt, aber anschauen wollen wir es uns schon, und wäre
es zwischen den vor die Augen gehaltenen Fingern hindurch. Was wir dort
aber wirklich sehen könnten, die totale Macht, der wir längst
verfallen sind, das wird uns als möglich gezeigt, weil in diesen
Filmen einfach ALLES möglich ist, nur damit man vergißt, daß
Tod in noch mehr Tod verwandelt wird, damit man dieses Prinzip unter sehr
viel Technik (das heißt: sich Auskennen mit etwas) und Effekten
gleichzeitig wieder verbergen kann. Solange wir aber nicht versuchen,
die Regeln in ihrem imaginären Raum hinter der Leinwand zu entziffern,
solange werden wir auch nicht entschlüsseln können, was diese
Schauspielerin dort auf der Leinwand tut. Doch das ist erst der Anfang.
Wir werden es nie wissen, und wenn wir in das Innerste ihrer Moleküle
vordringen würden. Es ist nur logisch, daß in Teil 4 die Heldin
Ripley aus Molekülen und DNA wieder ganz neu zusammengesetzt wird
und selbst nicht weiß, wer oder was sie ist, Untier oder Mensch.
Eine zweite, äußerlichere, Komponente ist, daß es Ripley
inmitten all des planetarischen Schutts und Mülls, den die Entropie
bereits hinterlassen hat, hinter all den Ursachen und Wirkungen, die man
hierzulande "Geschichte" nennt, aber in Wirklichkeit läuft
die ja Dahinter ab, eben hinter den Räumen, die uns zugänglich
sind, oft schwerfällt, überhaupt etwas zu tun, denn in diesen
Filmen ist die Leinwand meist sehr vollgeräumt, als wäre sie
mit einer wild gemusterten und auch noch lebendigen! Tapete zugeklebt,
von der sich die Heldin und ihre Mit-Spieler, die kleine Newt, Bishop,
der Androide - der zuerst nichts als ein sehr hochentwickelter (hoch-
"gezüchteter"!) Roboter ist, aber im Lauf der Filmhandlungen
immer menschlicher wird, bis er der Menschlichste von allen geworden ist,
Mensch und Maschine gleichzeitig, ein Schöpfergeschöpf, denn
jetzt merken wir es erst: der Androide hat ja die ganze Zeit das Gesicht
seines Meisters gehabt! (doch da ist schon wieder ein ganz andrer Raum,
in dem dann der Meister das Gesicht und das Innere seines Geschöpfs
angenommen hat, vielleicht weil er inzwischen verstorben ist?) - und die
Kämpferinnen und Kämpfer (alle scheinbar dem gleichen, androgynen,
muskulösen Geschlecht zugehörig mit Ausnahme des Kindes, das
als einzige eindeutig weiblich ist und auch so erscheinen darf - eine
Umkehrung der Legende vom noch "geschlechtslosen" Kind) nur
undeutlich abheben können; ja, sie müssen alle wild herumfuchteln,
schwitzen, Flammen werfen, schießen, rackern, um sich den Raum der
Leinwand irgendwie freizukämpfen und damit ihren Weg - anders übrigens
in Teil 3, "in der Strafkolonie", denn da haben die Protagonisten
überhaupt keine Waffen, außer den primitivsten, die man schon
in der Steinzeit hatte, und da müssen sie, die, beinahe vollständig
ausgezogen (stripped to the bones) und dazu sogar kahlgeschoren sind (was
die Androgynität natürlich bis zum Äußstersten steigert),
ihre Körper selbst als Waffen einsetzen, also: sich buchstäblich
selbst als Pfand einsetzen. Den Platz auf der Leinwand Einräumen,
Vollstellen, heißt, daß erscheinen darf, was je schon da,
was "auf Zelluloid gebannt" ist, um uns auf unsre Plätze
im Davor zu verweisen. Sich Platz auf der Leinwand zu schaffen, bedeutet,
von der Seite der Akteure her gesehen, ein vielarmiges amorphes Ungeheuer
von ihr erst mal zu vertreiben, das einfach überall ist, und scheint
es einmal nicht zu Hause zu sein, entsteht natürlich die Spannung
dadurch, daß man weiß, es ist da, aber werden die es noch
rechtzeitig finden? (na, die Filmmusik hilft ihnen wenigstens dabei),
ein tentakelbewehrtes Schauergeschöpf, zusammenschmelzend, schon
bevor es wirklich verbrannt wird (das alte Schicksal von Hexen!), ein
schauerlicher Embryo, über den sich Ripley, noch im Flammensturz,
mit dem sie die Welt rettet, sich aber mitsamt ihrem "Kind"
vernichtet, irgendwie beinahe sorgend beugt - die absolute Parodie auf
die Jungfrau Maria und das kleine Jesuskind. Das Ungeheuer wird, auch
wenn es wie ein Blitz herumzuckt und partialisiert auftaucht - wahrscheinlich
damit man das "Gemachte", Gebaute, Gebastelte der Sache nicht
allzu genau unter die Lupe nehmen kann - , also nur ein Stück Schwanz,
ein, zwei Sekunden der Kopf, etc. zu einem beweglichen Hintergrundmuster,
da es ja "überall" sein kann und überall ist, aus
dem heraus der Star Sigourney, die Anführerin, und ihre Mitspieler
sich Breschen schlagen müssen, um überhaupt einmal anständig
filmschauspielen zu können. Die Filmkunst setzt ja, wie jede andre
Kunst, bei der etwas entsteht, "gemacht" wird, ein Werk in Gang,
das alles um es herum verdrängt; manchmal kann man dieses Werk auch
Wahrheit nennen, jedenfalls besteht es aus Gängen und Räumen,
die aus dem unbewegten Raum herausgeschlagen werden.

Brigitte Helm und Heinrich George in METROPOLIS (Fritz Lang, 1926, Photo ORF), aus METEOR, 1997, 11
In Fritz Langs "Metropolis" von 1926 entsprechen diesen Tentakeln des Ungeheuers, des "Aliens - des Fremden", die bemalten, als Modelle gebauten, mit Spiegeln trickbelebten Gänge der Arbeiterstadt Metropolis, bei der Oben und Unten, Herrscher und Arbeiter, streng getrennt sind, und der Herrschersohn ist der Verbinder zwischen den beiden Sphären, der Wanderer, der die Bresche schlägt. Wie lebende Greifarme durchziehen die futuristischen Verkehrslinien das Filmbild, und die Arbeiter (Ernst Jünger bringt "Der Arbeiter" erst 1932 heraus, muß aber, denke ich mir, auch von diesem Film beeinflußt worden sein) füllen, fuchtelnde Wasserfluten, den Raum dann irgendwann einmal vollständig aus; die lebendigen Menschen verkitten sozusagen allen Raum zwischen den Verkehrsadern und den Verkehrsmitteln zu einem Ganzen, aus dem nichts mehr zu entfernen ist. Ja, die Straßen werden förmlich zu Menschen, die, vielleicht aus Angst vor der Leere, und aus Angst, daß es hinter der Leere noch eine weitere, viel umfassendere, geben könnte, in dieses Vakuum gesogen werden und dann das Eigentliche des Filmraums werden, sein Negativ, ein andres als jeder Film "natürlich" (ohne Negativ kein Positiv!) hat und haben muß. Bewegung entsteht durch eine intrikate, aber im Grunde simple Einzelchoreographie der Protagonisten, vor allem der Schauspielerin Brigitte Helm, die ja in einer Doppelrolle auftritt: jener der (heiligen Jungfrau - wieder eine!) Maria und des dämonischen, von einem Menschen geschaffenen Roboters, der Marias Züge trägt, darunter aber vollständig aus schimmerndem Metall besteht und die Massen zur Revolution aufhetzt, welche nur darin besteht, daß sie sich selbst, ihre Behausungen und ihre Kinder zerstören wollen. Das ist das Negativ der Revolution, die doch als Positiv gedacht war, aber nicht etwas Negatives, in das sie umkippt, sondern das "naturgemäße" Negativ, wie beim Film. Aber immerhin: in "Metropolis" ist der Herrscher, ist Die Firma noch zu sehen, so wie man die Rathenaus und die dämonischen Hugenbergs noch gekannt hat, in den Alien-Filmen zeigt sich der Konzern nicht mehr, nur seine Abgesandten zeigen sich noch. Die Katastrophe von Metropolis wird im letzten Moment von der hl. Jungfrau und dem mitfühlenden Unternehmerssohn verhindert, endlich einem, der die Parsifal'sche "Mitleidsfrage" einmal stellt (die Verbindung von Hand und Kopf, also Handarbeit und Kopfarbeit, "das Herz", und ohne dieses kann gar nichts gelingen, wie Fritz Lang sagt, vor allem das Atmen nicht, wie ich sage), die Revolte wäre "natürlich?" in jedem Fall, wie wir inzwischen vom Realraum ja gelernt haben, nicht gut ausgegangen. So. Der Feind kommt entweder von außen, das ist die harmlose Variante, oder von innen, dann wird es interessant (wir werden sehen, daß Metropolis wie Alien Mischformen sind und nicht zuletzt daher ihre Faszination beziehen), denn dieses Innen ist nicht einfach das Innere der Menschen, sind nicht einfach seine bösen oder guten Triebe und Pläne, sondern ihm entspricht eben auch ein ganz anderer Raum als der, den man sehen kann. In den "Alien"-Filmen kommt das Ungeheuer gleichzeitig von außen wie von innen, denn es wird fast immer erst als Ungeheuer erkannt, wenn es, geifernd, spuckend, fauchend, triumphierend, aus den Wirtskörpern, die es dabei zerfetzt, nach der Art eines Springteufels herausfährt, ausfährt wie ein böser Geist. Allerdings muß es zuvor in die Menschen hineingekommen sein. Wie löst Fritz Lang das Problem, seinen künstlichen Menschen, der ja auch von außen wie von innen kommt, ein Gemachtes ist wie etwas, das unerkannt "unter den anderen lebt" und als fremde Art nur vom Liebenden erkannt wird, seinen Roboter, der Marias, des Mädchens Züge trägt, einmal als Menschen, einmal als ins Verderben lockenden Dämon zu zeigen? Die Hexe Maria, das Böse schlechthin also (wichtig wäre zu sagen, daß Maria und Maria/Dämonin nicht nur identisch sind und natürlich von ein- und derselben Schauspielerin gespielt werden, sondern daß sie wirklich austauschbar sind, eine IST die andre, da das Böse, und hier kann das auch bewiesen werden, ja in letzter Konsequenz immer von Innen kommt, und nur die andre, die Böse, suggeriert uns diesen Zweitraum, der ein Ort ist, welcher den vorgegebenen verlassen und sich einen eigenen geschaffen hat, um sich dort entfalten zu können, uferlos, denn das Böse duldet, im Gegensatz zum Guten, das "etwas meint", im Sinn von Bedeuten, also zielgerichtet agiert, keine Abgrenzung), sitzt auf der Schulter eines der revoltierenden Arbeiter, die Massen drängen hinter ihr her, füllen die Projektionsfläche, als wären sie, genau wie Wasser eben, draufgeschüttet worden, und Maria-die-Teufelin, die Hände werfend und ein irres, gleichzeitig entrücktes Lächeln auf ihrem weichen Gesicht (man hat Brigitte Helm, die ja ein eher ovales, oder besser: herzförmiges Gesicht hat, nach der Mode der damaligen Zeit, für diese Szenen, in denen sie ja einmal nicht das unschuldige Mädchen ist, die Unterlider dunkel geschminkt, man hat ihr sozusagen künstliche Augenringe, das Zeichen der Dekadenz und der durchzechten Nächte, gemalt, was immer einen unheimlichen Effekt ergibt, einen lebenden Totenschädel - ähnlich schlicht mit etwas dunkler Farbe hergestellt auch, vierzig Jahre später, die Untoten in Herk Harveys "carnival of souls"!), dreht sich, und mit ihr natürlich der "Untermann", auf dessen Schultern sie breitbeinig sitzt, und der in Wirklichkeit sie dreht, rasend schnell, im wahrsten Sinne des Wortes "überdreht", im Kreis. (Die sich opfernde Ripley/Weaver sinkt mitsamt ihrem Ungeheuer/Kind, sich langsam um ihre Achse drehend, in resignierter Selbstaufgabe, schwebt, wie eine einzige skeptische Handbewegung ihres ganzen Körpers, in die Flammen hinab.) Aus dem Filmraum wird sozusagen, mittels einer aggressiven Kreiselbewegung, ein Segment förmlich herausgebohrt, ein Loch entsteht inmitten der Volksscharen, und durch dieses Loch, das von einem Menschen kraft Bewegung erzeugt wurde, kann dieser andere Raum, jener dahinter, vordringen, der dann das eigentliche Entsetzen beim Zuschauer auslöst. Dieser Raum Dahinter bohrt sich in ihn hinein und reißt ihn förmlich aus seinem Kinosessel heraus. Und, je mehr sich die Leinwand mit Menschenmaterial (die Arbeiter, das ist charakteristisch für sie, treten ja fast immer in "Massen" auf, bedrohlich, gesichtslos, amorph, daher geht eine solche Gefahr von ihnen aus, gleichzeitig sind sie aber Spielmaterial, man kann sie nicht auseinanderhalten, eigentlich sind sie Müll, Abfall, es gibt einfach zuviele von ihnen) füllt und wieder freigeräumt wird, scheinen die Massen nur aus dem Grund dort auf die Leinwand hinaufgeschickt worden zu sein, damit mit ihnen endlich aufgeräumt werde und wir dafür wieder mehr Platz haben, um leben und atmen zu können. Die Leinwand hat sich also angefüllt, das Wasser wird aber durch den Abfluß wieder abrinnen (Metropolis droht ja wirklich geflutet zu werden! Doch die wahre Flut sind eben die Menschen selbst), und dafür dürfen wir dann bleiben. Sind deshalb wir die eigentlichen Herrn der Leinwand? Haben wir sie gezielt für diese Vorgänge freigegeben, damit, wie in einem sakralen Akt, uns der Ort zum Wohnen wieder, heil und ohne daß man von fremden Elementen dabei gestört würde (diese fremden Elemente sind aber unter uns, nein, sie sind wir! Nicht im romantischen Sinn, daß wir alle Fremde auf Erden seien oder so, sondern umfassender: in der Totalität muß am Ende jeder dran glauben, auch wenn die Zerstörung ursprünglich nur einzelnen Gruppen gegolten hat), zurückgegeben wird? Ein paar Jahre nach "Metropolis" haben sie dann alle brav "Heil!" geschrien.
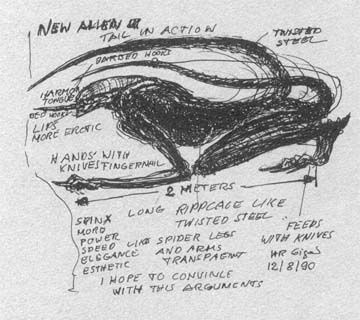
Skizze "New Alien" aus METEOR, 1997, 11
In
"Alien"-Filmen findet, oberflächlicher gesehen, umgekehrt
auch wieder ein Rückschritt noch hinter Fritz Langs ästhetische
(natürlich betrifft das nicht die technischen) Möglichkeiten
statt: Die Abstraktion des Filmkünstlers Lang wird in den Alien-
Filmen, wie in einem Kinderfilm, wieder re-konkretisiert und tritt, als
was wohl? natürlich! als vielarmiges Ungeheuer, als eine Art Hydra
auf, als Material und gleichzeitig materialisiert. In Metropolis tragen
die Menschen ihren Arbeitscharakter, also keinen, auf den anscheinend
immergleichen "nichts-sagenden" Massengesichtern, und diejenigen,
denen Individualität erlaubt ist, vor allem der Sohn des Herrschers
und natürlich der Herrscher selbst, heben sich deutlich, nicht nur
durch Kleidung und Großaufnahme, davon ab. Immerhin sind das Herrscher,
die noch gezeigt werden können, hinter denen man keine weiteren mehr
vermutet. Die Herrschaft hat es zu Beginn des kartellisierten Staates
noch nicht nötig, ihre Spuren zu verwischen, da ihr, "normalen"
Verhältnissen nichts streitig gemacht wird. Der Arbeitscharakter
der Figuren in "Metropolis" ist so stark, daß er sich
hinter diesen Nicht-Gesichtern verbergen muß (die Gesichter sind
wahrscheinlich erst entstanden, als die Arbeit in ihre Züge, wie
in Regale, eingeräumt wurde), und die Gesichter verschwimmen, verschwinden
und, im Gegensatz zu den Herrschern und Maria, die herausgehoben ist unter
den Weibern, sind sie nicht mehr als einzelne, individualisierte wahrnehmbar.
Erst in der "Revolution", die in Wahrheit ja gar keine ist,
werden dann, durch Großaufnahme, einzelne Arbeitergesichter wieder
aus der Masse herausgeschält. Können wir daraus schließen,
daß der Arbeiter erst in der Revolution, da blinder Wille (Er ist
dazu da, Revolution zu machen. Er soll keine Revolution machen.) den einzelnen
ergreift, wieder Mensch wird? Nein, können wir nicht.
Dieser Vorgang hat seine Parallelität auch in den Alien-Filmen. Dort
verschwinden die "Arbeiter" (in diesem Fall: die Kolonisten
und Weltraumkämpfer), die dem Alien und seiner immer weiter vorandrängenden
Brut (!) (von ähnlicher Naturhaftigkeit sind auch die Individuen
in "Metropolis", als wären sie frei zur Entnahme und damit
gleichzeitig zur Auslöschung freigegeben, und es sollten ja in Deutschland
bald Menschen aufgrund ihrer jüdischen Natur ausgemerzt werden!)
gegenüberstehen, vor dem Hintergrund ihres riesigen "Werkstücks",
der vielarmigen Hydra, des Kraken, das sie nicht vernichten können,
das sie nicht vernichten DÜRFEN, denn sonst gäbe es ja nicht
immer neue Fortsetzungen, aber das ist eben nur EIN Grund (und was sind
dabei die Interessen Der Firma?). Die Konversion des "Arbeitscharakters"
der Massen, bzw. der Kämpferklasse (im dritten Teil: "primitive"
Sträflinge, meist Vergewaltiger, Fleisch, das sich auf Fleisch gestürzt
hat, aber durch den Kampf gegen die Bestie nun offenkundig zum Kämpfer,
wenn auch ohne technische Hilfsmittel, geadelt werden kann) in den Alien-Filmen
in reinen Kampf-, Kriegscharakter trägt in beiden Filmen immer auch
noch Werkstättencharakter, wenn man bedenkt, wie laut- und restlos
Vernichtung längst stattfinden kann und stattgefunden hat. Bedeuten
die Alien-Filme eine Art künstlerischer Regression, vergleichen mit
"Metropolis"? Kann man es so interpretieren, daß ein Übertritt
von der rein menschlichen Konstruktion "Die Stadt", einem Komplex,
der als etwas Gemachtes zu erkennen ist und die unaufhaltsame Herrschaft
der Technik, die wiederum kein Begriff des Machens, sondern einer des
Wissens ist, signalisiert, stattgefunden hat, und zwar hin zu einer organischen
Konstruktion namens "Das Ungeheuer"? Und gleichzeitig wäre
dann eine geistige, dynamische Abstraktion, eine von Menschen übernommene
Planung von Lebensraum, welcher nach diesen Menschen greift, sie aber
andrerseits als solche überhaupt erst hervortreten läßt,
paradoxerweise gerade indem er mit den Menschen, die dort wohnen, aufzuräumen
scheint und dadurch ihnen ja den Platz überhaupt erst frei-"räumt"!
übergeführt worden in Natur, in ein Wesen, halb Tier, halb Pflanze,
das anfänglich aus einer Art Schote kommt (ein beliebtes Science-Fiction-Bild)
sozusagen Natur ersten Grades, während die Naturhaftigkeit zweiten
Grades der Metropolis-Bewohner, sosehr sie betont ist, um sie verschwinden
lassen zu können, doch eine durch menschliche Arbeit erreichte, buchstäblich
aus ihnen herausgemeißelte wäre. Und ihr Produkt, die gigantische
Maschine in der Mega-Stadt-Maschine (also Maschine in der Maschine), Der
Moloch im Film, ist zu sehen, drängt sich, als alles Überragendes,
in die Beachtung, während die Technik, normalerweise das wichtigste
in Sci-Filmen, "Alien" hinter der scheinbar "reinen Natur"
des Ungetüms zurücktritt und dieser auch bereitwillig Platz
macht, bis, wie gesagt, diese Natur die Leinwand überwuchert hat.
Ich habe allerdings am Anfang dieses Textes zu beweisen versucht, wie
trügerisch Naturhaftigkeit ist und daß das auch gezeigt wird,
daß sie möglicherweise sogar die raffiniertere Form des Gemachten
ist, da man ja nicht weiß, ob das Alien nicht von Der Firma hergestellt
wurde bzw. ob die Firma nicht überhaupt das Alien IST. Anders gesagt:
Während "Metropolis" die Spannung zwischen Natur und Zivilisation
betont, indem die Menschen das von ihnen Geschaffene letztlich behalten
dürfen und damit siegen (das sentimentale Drumherum braucht uns in
diesem Zusammenhang nicht zu kümmern), wird gerade die Naturhaftigkeit
in den "Alien"- Sci-Filmen als der Höhepunkt des Gemachten,
Verfertigten, was ja nur heißt, daß etwas in die Welt hineingestellt
wurde als etwas, das vorher nicht als ein Anwesendes vorlag, vorgeführt,
vielleicht weil diese Filme inzwischen ja über jede Technik verfügen
und daher Zukunftsvisionen zeigen können, in denen die Darsteller
auf Technologien, die noch gar nicht erfunden sind, Zugriff haben. Die
Natur wird gezeigt als eine siegende, auch über die Technik siegende.
So sieht es vordergründig aus. Daß es so nicht stimmt, habe
ich zu zeigen versucht. Ein zwar außerirdisches, aber immerhin eindeutig
lebendiges Wesen scheint zwar immer wieder über all die Superwaffen
und damit auch über die Menschen zu triumphieren, denn diesen Filmen
ist ja immanent, daß sie immer weitergehen müssen, sonst wärs
aus mit ihnen. Aber dieses Wesen ist wahrscheinlich auch nur Technik (was
es im Film ja im wahrsten Sinn des Wortes ist), und die Herren der Technik,
die "sich auskennen" in dem Sinn, daß sie erkennen was
es zu erkennen gibt und wissen was es zu wissen gibt, haben ihre Gründe,
weshalb sie der Natur, die nicht zu beherrschen ist, nicht trauen und
sie lieber selber machen wollten, und zwar aus dem und mit dem, was heute
ist, was sie heute können, und daher in der Zukunft immer noch besser
können werden.
In einer ihrer besten Szenen muß Sigourney Weaver, in "Alien
2", um das kleine Mädchen Newt zu retten, als lebender Mensch
sich durch eine Maschine sozusagen erweitern. Sie steigt in eine Art riesigen
stählernen Greifbagger, um ihre Person zu vergrößern,
um außen eine Maschine an sich anzubauen, die sie einerseits schützen,
andrerseits das Ungeheuer von ihr abhalten soll. Sie wird unangreifbar,
indem sie ihren Körper in die Maschine zwängt und seine Greifarme
in Richtung Ungetüm bewegt. Die Hydra kann nicht an sie heran, aber
die Greifklauen aus Stahl können die Hydra ergreifen und zerquetschen.
Doch im Grunde ist gerade dieser Versuch Ripleys, die Technik buchstäblich
in die Hand zu bekommen und die Natur in den Griff, ein Rückgriff
auf die kritiklose Bejahung der Technik als etwas Unausweichlichem, entspricht
also einer gängigen Vorstellung von Technik als Instrumentalität,
und wirkt so beinahe wie ein Rückschritt im Vergleich zu jenem Raum,
der von Herren (und ihren "Instrumenten", den Arbeitern) in
"Metropolis" beherrscht wird, und der auf seine Weise ja auch
planetarische, alles, auch das Draußen umfassende Dimensionen besitzt,
die man hinter ihm ahnt: Der Weltraum des Weltraums! In Richtung Alien
müssen die Planeten selbst ihre Leute ausschicken, in die "Kolonien",
ein beinahe dörfliches Idyll, denn zu diesem Zweck müssen, auch
wenn sich Gräßliches und Aufregendes in ihnen abspielt, eben
kleine überschaubare Außenstellen, Doubles der Erde errichtet
werden, um die Ereignisse konkret zu verorten. Metropolis aber ist überall.
Davon ausgehend, kann man den Planeten beherrschen und jede Konstruktion
Wirklichkeit werden lassen, auch die Frau als Roboter, die eine ununterscheidbar
vom anderen (nur die Stimme der Liebe, der Sohn des Herrschers, kann zwischen
ihnen unterscheiden, die übrigen erleiden inmitten all der Technik
einen Rückfall in archaische Zeiten und Vorstellungen, der die Massen
dazu treibt, die "Hexe" zu verbrennen. Die aber lacht nur, sie
ist ja kein Mensch und kann daher nicht sterben, was sie natürlich
weiß. In einer interessanten Entsprechung zur Hexenverbrennung in
"Metropolis", bei der ja in Wahrheit ein künstliches Konstrukt
verbrannt wird, stürzt sich in "Alien 3" Sigourney Weaver,
die das Positiv einer Hexe ist, also die gute - weiße - Frau, die
die Welt vor dem Ungeheuer rettet, das "in ihrem Leib heranwächst",
also dem Bösen, das nun buchstäblich in ihr ist, selbst ins
Feuer, aber den Bruchteil einer Sekunde lang ist sie dem Ungeheuer eben
auch: eine Mutter!), und mit Hilfe derselben Technik wird, das führt
ein Film wie "Metropolis" deutlich vor Augen, in dem die Schaffung
des Roboters ein quasi medizinischer Schöpfungsakt ist, kein technischer,
denn Brigitte Helms Gesicht wird dem Automaten aufprojiziert wie im Mickymausheft
durch den genialen Daniel Düsentrieb das Gemüt eines mißmutigen
Schweins auf ein fröhliches und umgekehrt, also Helm, Drähte,
Gebritzel zwischen beiden, es wird nichts gelötet, geschweißt,
geschnitten, der moderne Mensch, der Massenmensch, die Welt übernehmen,
dessen Revolutionen immer wieder scheitern werden, der aber trotzdem,
es gibt einfach zu viele von ihm, nicht umzubringen sein wird. Sehen wir
es einmal mit unschuldigen Augen, welche Die Firma noch nicht geschaut
haben, die, wie gesagt, ohnedies noch keiner gesehen hat, dann könnte
die Sache andrerseits auch wieder recht einfach sein, so wie aus der Sicht
des Arbeiters die Sache immer auch: einfach ist, er muß nämlich
arbeiten um zu leben. Während die Bekämpfer der Fremden Wesen,
der Aliens (und für die "Aliens" sind natürlich wiederum
die fremden Kolonisten: aliens), hier also ihre Medizinstation aufgestellt
haben und dort ihren Androiden, den - immer "menschlicher" werdenden
Abgesandten Des Kartells (übrigens auch ein Hinweis, daß die
Natur die äußerste Ausformung von Technik sein könnte
und Die Firma den Menschen mit Der Natur nur etwas besonders Raffiniertes
vorgaukelt: der Androide eben als menschlichster Mensch), dort drüben
die Schlafkabinen und noch den und den Raum, den es zu erobern und zu
halten gilt, und dahinter, ohne daß sie einer geklebt hätte
(oder doch?) immer wieder diese Tapete, dieser originelle, aber letztendlich
doch etwas schlichte Hintergrundeffekt, diese außerirdische Wucherung,
die zwar das Wesentliche des Films ist, aber wesentlicher muß selbstverständlich
die Heldin sein, Sigourney, die, am Ende schon fast resignierend, das
Monster bekämpft, in einem Kolonisationsakt, der jedes Mal aufs neue
gerade noch gut geht, aber suggeriert, daß es das nächste Mal
wahrscheinlich nicht mehr klappen wird (Fortsetzung 3, da glaubt man wirklich,
jetzt ist es aber endgültig aus), und damit wird uns natürlich
auch jedes Mal aufs neue suggeriert, daß diese kolonisierbaren Räume
nur deshalb da sind, damit Menschen mit Entschlußkraft, vorgerecktem
Kinn (ungeschminkte Frauen im Film!), Liebe zu Kindern und einer guten,
zum Glück schlanken und langbeinigen Figur in vernünftiger Baumwollunterwäsche
wie auch ich sie trage (da ist das schlichte Baumwollkleidchen Marias
in Metropolis ja geradezu übercodiert dagegen!), sie immer wieder
unermüdlich freikämpfen können, um sich dann dort, in diese
schöne neue Kolonie, die auszubeuten ist (endlich ist er, ebenfalls
ungeschminkt, da, der Zweck von dem ganzen: Ausbeutung), an Stelle derer,
die vorher da waren, selbst hineinzusetzen. Und das ganze Gerümpel,
die ganzen schweizerischen Untier-Konstrukte und Belebungstricks, bewirken
nur, daß jener tiefere und profundere Schrecken beim Betrachter
einmal doch wieder ausbleiben wird, weil der Untergang immer auch Triumph
(der Heldin) ist. Das Organische der Technik (ein Ungeheuer, das mittels
Technik hergestellt wurde) und das Mechanische der Menschen (roboterhafte
Arbeiter), dieser Gegensatz besteht immer noch und bedeutet, daß
die Menschen ihren Räumen nicht, keinen Räumen gewachsen sind.
Also müssen sie mit ihren organischen wie technischen Konstruktionen
sich Räume erst freimachen ("Raum im Osten schaffen", das
war einmal schon die schreckliche Folge, daß Belebtes aufgeräumt
wurde, damit andres, angeblich andersartig Belebtes, selbstverständlich
von höherem Rang, einziehen könne).
Das Freiräumen von Orten bedeutet jedoch nicht, daß es dahinter
nicht andre, gefährlichere geben könnte, mit denen man uns drohen
kann und die, da sie nicht mehr geräumt werden können, weil
man nicht hineinkommt, in letzter Konsequenz auch nicht mehr zu benennen,
nicht einmal zu zeigen sind. Dort wohnt dann Das Kartell selbst. Wir müssen
draußen (drinnen?) bleiben. Die Kolonisten wie die Strafkolonisten
in Teil 3 strengen sich an, das Untier zu zerstören, sie sind mit
Schweiß überzogen, reine, personifizierte Mühe, als wären
sie selbst Dinge, die, wiedrum durch Anstrengung, von andren hervorgebracht
worden sind. Doch Anstrengung allein genügt nicht, ist noch keine
Leistung an sich. Mir kommt vor, als dienten all die Mühen in diesen
Filmen nur dazu, aus einer amorphen Masse an Menschen, die sich da abplagen,
wieder Einzelwesen, Individuen zu erzeugen. Aber wehe, wenn die dann losgelassen
würden! Am Ende fallen sich Frieder und Maria in Metropolis in die
Arme und ergeben 1 Stück Paar, und auch Sigourney kommt davon, wenn
auch am Ende von Teil 3 ziemlich zermantscht, eigentlich: verbrannt, aber
das sieht man nicht mehr, sie kann aber offenkundig rekonstruiert werden,
doch was aus ihr wird, scheint eine neue Gattung zu sein, eine neue Spezies,
halb Person, halb Funktion, bzw. die Funktion ist ihr in Fleisch und Blut
buchstäblich übergegangen. Ist das ein Rückschritt zu Teil3,
in dem Fleisch und Fleisch sich sozusagen nackt und geschlechtslos gegenüberstehen
mußten, und sogar die kleine Newt nur mehr ein Fleischklumpen ist,
der, unter den Blicken der "bis ins Mark" getroffenen Ripley,
seziert wird? Wer oder was wartet denn in Teil 4 eigentlich auf diese
völlig neue Art, die wir da frisch hereinbekommen haben? Wieder einmal,
wie schon immer: Herrschaft. Weil was leer ist auch beherrschbar werden
soll, weil was chaotisch ist auch die Strenge des Gesetzes kennenlernen
soll, das aber dann wirklich für alle gelten wird, weil was noch
nicht da ist vielleicht einmal noch kommen wird. Es wird vielleicht sogar
das Ewige einmal über die Zeit kommen, dann müssen da Dinge
stehen, die dem gewachsen sein werden, und die von uns kommen, auch wenn
sie uns niemand zugetraut hat, und wäre es, daß dann einfach
wir hier wohnen und es uns nicht gefallen lassen.
Als hätte der Regisseur das geahnt, hat er Sigourney Weaver also
im bisher letzten Teil, dem vierten (ich habe ihn noch nicht gesehen)
offenkundig, da ihm die rein technischen Möglichkeiten und Ideen
langsam ausgehen (und er, in Teil 3, schon auf die "natürlichen"
zurückgreifen mußte), ähnlich der bösen Maria, dem
Roboter, in Metropolis, da Sigourney/Ripley ja verbrannt, also restlos
tot, ist, mithilfe ihrer DNA-Formel wieder neu zusammengesetzt, und nun
scheint sie nicht genau zu wissen, ob nicht auch DNA-Masse des Aliens,
welches sie, Ripley, getötet hat, bzw. welches sie in und mit sich
gemeinsam getötet hat, in ihre Gene eingedrungen ist. Das wird interessant,
denn jetzt ist der Feind eindeutig, ohne jeden Zweifel, ohne jede Ambivalenz,
in einem selbst, aber man weiß es wieder einmal nicht genau. Oder
man ist selbst sein eigener Feind. Na, aber gewiß doch! Das ist,
immerhin, ein neuer Ansatz, daß nämlich die Heldin selbst nicht
mehr weiß, ob sie menschlich ist oder nicht. Daß die Heldin
wirklich, gerade indem sie Negativ wie Positiv in einem ist, "außerhalb"
bleiben darf, wie alle Helden letztlich, und auch ein andres Symptom spricht
dafür: Die Schauspielerin hat sich in einem Interview beklagt, daß
in Teil 3 jene kurze Sequenz, etwa drei Minuten, aus dem Film herausgeschnitten
worden seien, die zeigen, was Sigourney Weaver/Ripley überhaupt ticken
lasse: ihre Tochter nämlich, und daß dieser aus Gründen
der Zeitüberschreitung erfolgte Schnitt (im director's cut auf Video
ist die Sequenz vorhanden!) das ganze habe kippen lassen, die Geschichte
geändert habe ("If you bust your gut trying to play a character
and then they take away your raison d'etre, it's such a slap in the face".
In demselben Interview erzählt Weaver übrigens auch, daß
sie selbst schwanger geworden sei, ein Kind gewollt habe, weil sie sich
mit der Darstellerin der kleinen Newt so gut verstanden habe! Wenn das
nicht heißt, daß Kunst und Leben ineinander übergehen
können...!). Die Frage ist: Wurde dieses biographische Detail veilleicht
auch aus dem Grund aus dem Leben Ripleys geschnitten, um ihr Menschsein
zu unterlaufen? Um etwas anderes-als-einen- Menschen aus ihr zu machen,
was sie in der bislang letzten Folge offenkundig wird? Wahrscheinlich
wäre es wieder Paranoia, das zu glauben. Man wird von Sigourney Weaver
wissen, daß sie dann immer noch durchsichtige Kleider und Bleistiftabsätze
tragen und aussehen wird, als ob sie das jeden Tag täte, und zwar
weil sie es ja ganz gewiß oft tut. Wie sich Brigitte Helm privat
gekleidet hat, weiß ich nicht. Sie sind beide ja auch Räume
hinter den Räumen, aber solche, die wir ruhig sehen dürfen.